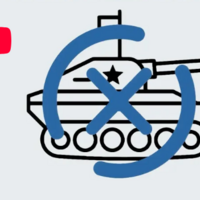Frieden
Nie wieder Krieg. Das wünschen sich Menschen weltweit. Aber überall auf der Welt gibt es Kriege, bewaffnete Konflikte, Terror. Was sagt die Kirche dazu?
Gregor Rehm beantwortet Fragen zu Wehrpflicht, Einberufung und Kriegsdienstverweigerung.

Das Interview hat Florian Riesterer im Juni 2025 mit Gregor Rehm, dem Beauftragten für Friedensfragen der Evangelischen Kirche der Pfalz, geführt.
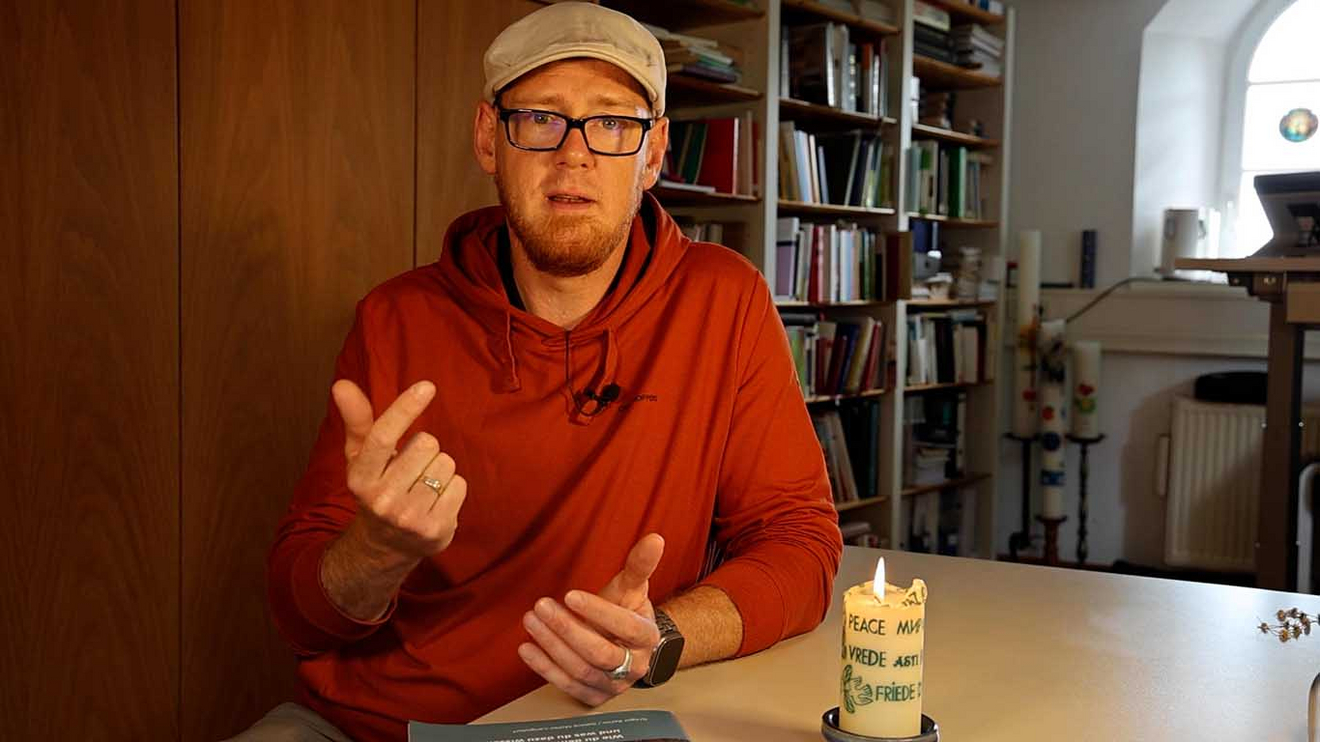
Kommt die Wehrpflicht wieder?
Die Wehrpflicht ist nicht abgeschafft, die Einberufung ist ausgesetzt. Diskutiert wird, ob die Einberufung wieder stattfindet. Momentan ist das auf freiwilliger Basis geplant. Niemand muss deshalb befürchten, dass er gezwungenermaßen Wehrdienst oder einen Ersatzdienst leisten muss.
Und was ist, wenn ein allgemeiner Pflichtdienst kommen sollte?
Wenn ein gesellschaftliches Pflichtjahr kommt, müsste ich einen solchen Dienst leisten. Zum Dienst an der Waffe gezwungen werden kann aber niemand. Im Grundgesetz steht in Artikel 4, Absatz 3: Niemand darf gegen seinen Gewissen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Und wenn man den Wehrdienst nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, muss es einen entsprechenden Ersatzdienst geben.
Sollte ich trotz ausgesetzter Einberufung verweigern, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren?
Das ist durchaus sinnvoll. Wenn es einen Spannungs- oder Verteidigungsfall gäbe, würde die Wehrpflicht ja automatisch wieder in Kraft treten.
Wer kann verweigern?
Ein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung können alle stellen, die wehrpflichtig sind. Das sind in Deutschland alle Männer zwischen dem 18. und dem 65. Lebensjahr, die diensttauglich sind. Voraussetzung ist also eine Musterung, bei der ein Arzt die Diensttauglichkeit feststellt. Auch Soldaten und Reservisten können verweigern.
Müsste ich Wehrdienst leisten, wenn ich Transfrau bin?
Aktuell ist vom Grundgesetz nur gedeckt, dass Männer zur Wehrpflicht einberufen werden können. Es kommt also darauf an, ob im Personalausweis als Geschlechtsmerkmal „männlich“ eingetragen ist.
Ich bin noch keine 18 Jahre alt. Kann ich verweigern?
Ich kann ein halbes Jahr vor der Volljährigkeit einen Antrag stellen, werde dann aber auch zur Musterung eingeladen.
Wie läuft eine Musterung ab?
Die Musterung ist in erster Linie eine körperliche Gesundheitsuntersuchung, ähnlich beim Eintritt in den öffentlichen Dienst. Es gibt auch psychologische Fragestellungen. Aber aus den letzten Berichten haben wir keinen Hinweis, dass das ein schikanöses Verfahren ist, wie das in alten Musterungsbeschreibungen zu lesen ist.
Was muss rein in einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung?
Er besteht aus drei Teilen. Teil eins ist das formelle Anschreiben. Darin nehme ich Bezug aufs Grundgesetz, Artikel vier, Absatz drei: Niemand darf gegen seinen Gewissen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Das zitiere ich am besten. Und dann gibt es zwei Anlagen: Einen tabellarischen Lebenslauf, wie man es von einer Bewerbung kennt, aber ohne Fotos und Zertifikate sowie der eigentliche Hauptteil – die Begründung der eigenen Gewissensentscheidung.
Was genau ist diese Begründung?
Ich erkläre darin, wie ich dazu komme, heute zu sagen: Mit meinem Gewissen ist der Dienst an der Waffe nicht vereinbar. Da geht es vor allen Dingen um zwei Kriterien: Ob das Ganze glaubwürdig und nachvollziehbar ist.
Und wie wird die Begründung nachvollziehbar und glaubwürdig?
Es gibt dafür kein Muster, sondern es beginnt mit dem Blick in die eigene Biografie. Wie komme ich zu dieser Entscheidung? Wenn ich bisher keinen Kontakt zur Bundeswehr hatte, kann ich bei meiner Erziehung beginnen, bei Dingen, die mich geprägt haben. Und wenn ich schon mal Dienst geleistet habe, ist die Frage, was sich seitdem verändert hat in meiner Überzeugung.
Wo setzt die Beratung der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) an?
In der Beratung arbeiten wir daran, herauszufinden, was einen Einfluss gehabt hat. Oft ist das ja kein bewusster Prozess, sondern ich stelle irgendwann fest: Ich habe mich verändert. Dann geht es darum, sich selber nachzuspüren. Wie hat sich das entwickelt? Wir haben eine Reihe Fragen, die dafür hilfreich sind. Auf der Homepage kann ich über ein Formular eine Beratungsanfrage stellen. Zeitnah kontaktiert dann ein Berater oder eine Beraterin.
36 % würden sich in einer aktuellen Umfrage des Meinungsinstituts INSA für den Wehrdienst entscheiden, 51 % für einen alternativen Pflichtdienst
47 % sprechen sich für eine Rückkehr der Wehrpflicht aus, 34 % lehnen sie ab
2023 haben 1.609 Personen in Deutschland den Kriegsdienst verweigert, 2022 waren es noch 1.123.
Bis zum 31. August 2024 sind 2.053 Anträge zur Verweigerung des Kriegsdienstes eingegangen.
Welche Fehler sollte ich beim Schreiben vermeiden?
Der größte Fehler wäre zu googeln, irgendwo eine Begründung zu finden à la copy und paste. Wenn Sie etwas bei Google finden findet das das Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben, wo die Anträge geprüft werden, auch. Dann wären weder Glaubwürdigkeit noch Nachvollziehbarkeit gegeben.
Wo schicke ich meinen Antrag hin?
Der Antrag geht ans zuständige Karrierecenter der Bundeswehr im eigenen Bundesland. Das prüft, ob schon ein Diensttauglichkeitsbescheid, also ein Musterungsergebnis vorliegt. Das wird beigelegt oder es wird zur Musterung eingeladen. Wenn die Unterlagen vollständig sind, leitet das Karrierecenter das ganze Paket weiter an das Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben. Bei Soldaten wird noch eine Stellungnahme der Dienstvorgesetzten eingeholt und die Dienstakte beigelegt.
Wie hoch sind die Chancen auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer?
Wenn jemand den Antrag aus ehrlichen Gewissensgründen stellt, ist die Anerkennungsquote meines Erachtens bei 100 Prozent. Schließich ist es ist ein sehr rechtsstaatliches Verfahren, das nicht darauf angelegt ist, Leute durchfallen zu lassen. Soldatinnen und Soldaten haben es mitunter etwas schwieriger.
Was mache ich, wenn mein Antrag abgelehnt wurde?
Wenn ein Antrag nicht im ersten Anlauf durchkommt, stellt das Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben Rückfragen. Diese Rückfragen sind auf den Antrag hin formuliert. Ich habe also die Möglichkeit, noch mal nachzusteuern. Sollte das Bundesamt dann den Antrag trotzdem ablehnen, kann ich in einem zivilrechtlichen bzw. verwaltungsrechtlichen Verfahren versuchen, die Anerkennung einzuklagen.
Wo bekomme ich hier Rechtsberatung?
Für die allermeisten Fälle reicht die inhaltliche Beratung. Die Rechtsberatung ist in der Regel für Soldatinnen und Soldaten im aktiven Dienst sinnvoll, etwa, wenn es um die Frage geht, ob Ausbildungskosten zurückzuzahlen sind und in welcher Höhe. In solchen Fällen können wir in der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Kriegsdienstverweigerung und Frieden Anwälte vermitteln, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben.
Was kostet die Beratung?
Die grundlegende Beratung, die wir in der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft anbieten, ist kostenfrei. Die Rechtsberatung bei den einzelnen Anwälten ist sehr verschieden gestaffelt und orientiert sich immer am einzelnen Bedarf.
Welche rechtlichen Grundlagen habe ich als Verweigerer?
Die erste relevante Größe ist natürlich das Grundgesetz mit Artikel vier. Er hat als einer der ersten Artikel im Grundgesetz einen sogenannten Ewigkeitswert, ist also sehr, sehr hoch in unserem Rechtssystem angesiedelt. Dazu gibt es das Kriegsdienstverweigerer Gesetz (KDVG), in dem genau geregelt ist, wie so ein Verfahren abzulaufen hat Und es gibt, je nachdem, noch das Soldatengesetz, das eine Rolle spielen kann oder das Wehrpflichtgesetz. Das ist vom Einzelfall abhängig.
Wo finde ich weitere Informationen?
Wir haben auf der Homepage der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Kriegsdienstverweigerung und Frieden Material zusammengestellt. Da gibt es zum Beispiel ein Erklärvideo, wo der Ablauf in einem KDV-Verfahren genau beschrieben ist. Zur eigenen Reflexion der Gewissenshaltungen haben wir die Broschüre „Wehrdienst oder Kriegsdienstverweigerung Findet deinen Weg“ herausgegeben. Dargestellt sind darin grundlegende Aspekte von Verantwortung, von Freiwilligkeit. Wir stellen die Frage nach menschlicher Sicherheit und staatlicher Sicherheit und präsentieren verschiedene inhaltliche Vorstellungen. Das alles soll dabei helfen, die eigene Haltung zu reflektieren, so dass man am Ende tatsächlich zu einer aussagefähigen Entscheidung kommen kann.